Nachlese: PFAS-Awareness-Workshop VI
Rund 90 Personen vor Ort und etwa 300 Teilnehmer:innen online nutzten den PFAS-Awareness-Workshop VI, um sich über neueste Entwicklungen zu Umwelt- und Produktmonitoring sowie über Alternativen zu PFAS auszutauschen. Elf Vorträge aus Verwaltung, Forschung, Industrie und Nichtregierungsorganisationen zeigten, wie breit das Thema mittlerweile in der Praxis angekommen ist – von Konsumprodukten über Abwasser und Böden bis hin zu Infrastruktur- und Verkehrsprojekten.
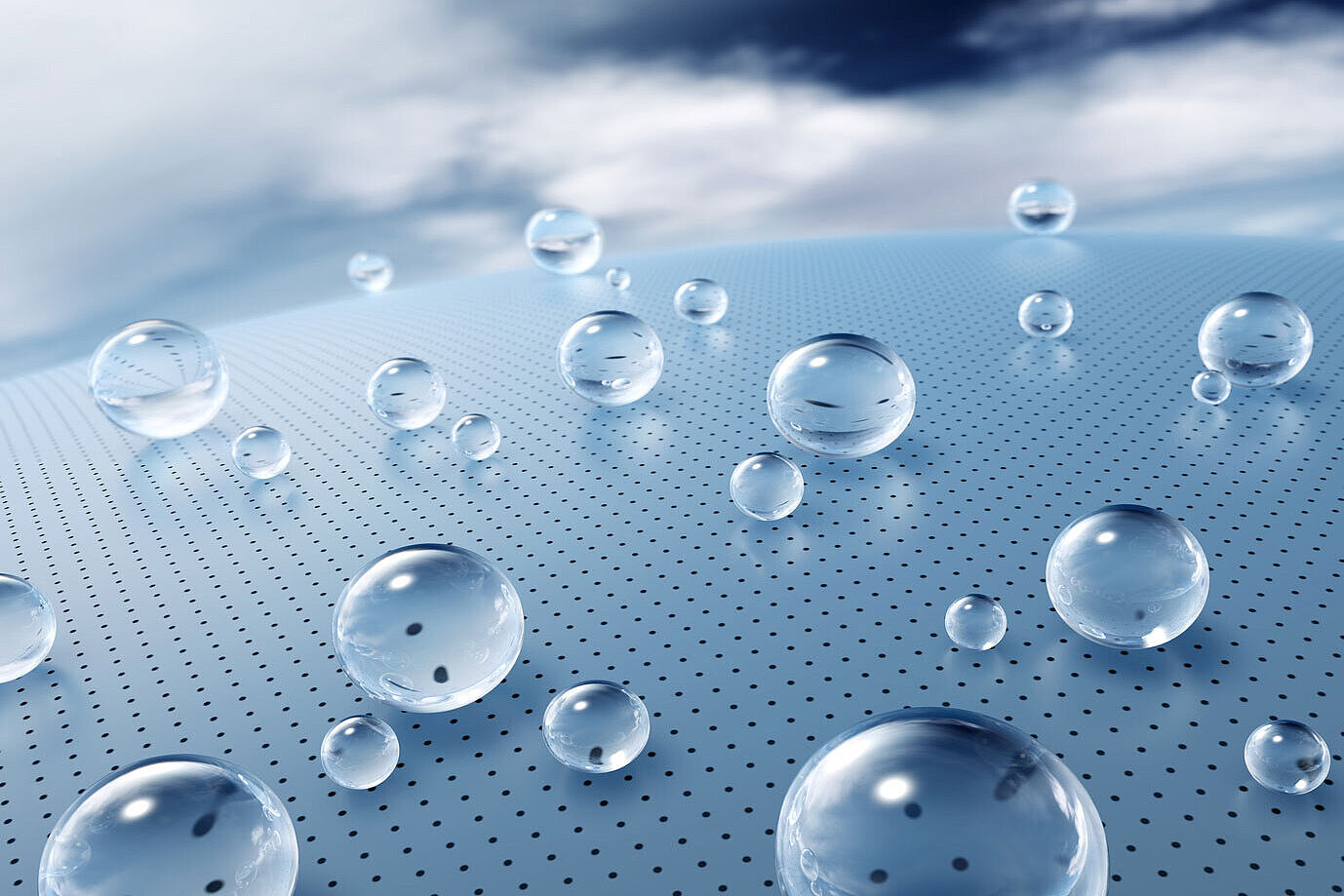
PFAS in Alltagsprodukten und Umwelt – was Messprogramme zeigen
Zum Auftakt präsentierte Birgit Schiller vom Verein für Konsumentenschutz die Ergebnisse einer Untersuchung von 229 Produkten auf PFAS. Rund 70 % der getesteten Produkte waren PFAS-frei, bei 21 % wurden jedoch die aktuell gültigen bzw. ab 2026 geplanten Grenzwerte überschritten. Die Ergebnisse unterstreichen, dass Konsument:innen zwar zunehmend PFAS-freie Alternativen finden, Belastungen aber weiterhin deutlich über zulässigen Werten liegen können.
Mehrere Beiträge widmeten sich der Frage, wie sich PFAS-Belastungen in der Umwelt möglichst früh erkennen lassen. Viktoria Müller von der Universität Graz zeigte, dass Bienen, Pollen und Honig als Bioindikatoren für kurzfristige PFAS-Einträge geeignet sind. Langfristige Belastungen wurden dagegen anhand von Wildtieren wie Wildschweinen und Hirschen untersucht. So entsteht ein mehrstufiges Bild: von der kurzfristigen Exposition im Umfeld von Siedlungen und Landwirtschaft bis zu längerfristigen Einträgen in Ökosysteme.
Abwasser, Böden und Grundwasser im Fokus
Philipp Hohenblum vom Umweltbundesamt Österreich stellte Ergebnisse einer Studie zu Emissionen aus kommunalen Kläranlagen vor. Untersucht wurden 25 Anlagen auf insgesamt 184 Spurenstoffe, darunter 29 PFAS. Die Analysen zeigten klar: PFAS sind relevante Spurenstoffe im Abwasser und müssen bei zukünftigen Maßnahmen zur Gewässerreinhaltung mitgedacht werden.
Kathrin Schmidt vom Umweltbundesamt Deutschland präsentierte ein Diskussionspapier zur PFAS-Belastung in Böden. Darin werden der Bedarf an europäischen Handlungsempfehlungen und die Rolle der öffentlichen Bewusstseinsbildung hervorgehoben. Deutlich wurde, dass ohne gemeinsame Leitlinien und einheitliche Bewertungen das Risiko besteht, Belastungen zu unterschätzen oder unterschiedlich zu beurteilen.
Wie sich PFAS-Hotspots im Zuge der Altlastensanierung konkret nachvollziehen lassen, zeigte der Beitrag von Gernot Döberl vom Umweltbundesamt Österreich: Für zwei Standorte konnten der Flughafen Salzburg und die Landesfeuerwehrschule Lebring als Quellen identifiziert werden. Untersuchungen weiterer größerer Flughäfen sowie Feuerlöschübungsplätze sind bereits in Bearbeitung bzw. Planung.
Ein Blick in die Schweiz verdeutlichte, dass auch der Bausektor eine Rolle spielt: Gunter Adolph von der SBB AG berichtete von PFAS in Spritzbeton und Baustellenabwasser. Untersuchungen zeigen, dass auch ohne die Freisetzung von PFAS gebaut werden kann – entsprechende Leitfäden werden erarbeitet und sollen die Infrastrukturbaubranche dabei unterstützen, zusätzliche PFAS-Einträge in die Umwelt zu vermeiden.
Gesundheit, Trinkwasser und Regulierung
Die gesundheitliche Dimension wurde unter anderem am Beispiel von Trifluoracetat (TFA) diskutiert. Franziska Kupprat vom Bundesinstitut für Risikobewertung erläuterte, dass die deutsche Behörde vorschlägt, TFA als reproduktionstoxisch der Kategorie 1B (wahrscheinlich reproduktionstoxisch; Daten aus Tierstudien vorhanden) einzustufen. Grundlage sind Langzeitstudien an Ratten und Kaninchen. Die Einstufung würde die regulatorische Behandlung von TFA deutlich verschärfen.
Lukas Meusburger stellte im Namen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) provisorische Trinkwassertoleranzwerte für erweiterte PFAS vor. Ziel ist es, insbesondere Säuglinge und Kleinkinder besser zu schützen. Die Werte sollen als Orientierung dienen, bis europaweit harmonisierte Grenzwerte und rechtlich verbindliche Regelungen für weitere PFAS vorliegen.
PFAS-freie Materialien und Technologien in der Praxis
Mehrere Beiträge zeigten, dass Alternativen zu PFAS in Produkten und technischen Systemen bereits umgesetzt werden – wenn auch oft mit Herausforderungen.
Die Marshall Group AB arbeitet daran, PFAS in ihren Elektronikprodukten (z. B. Kopfhörer und Lautsprecher) zu reduzieren. Anna Forsgren berichtete über laufende Maßnahmen und die Rolle von Bewusstseinsbildung: Ziel ist es, weitere Unternehmen zu motivieren, auf PFAS-freie Elektronik umzustellen und eine entsprechende Nachfrage entlang der Lieferketten zu schaffen.
Carsten Wachsmuth und Christian Ohse von der Volkswagen AG stellten Wärmepumpen vor, die mit dem natürlichen Kältemittel CO₂ (R744) betrieben werden. Bereits rund eine Million Fahrzeuge sind mit diesen Systemen ausgestattet. Die Beispiele zeigen, dass der Einsatz natürlicher Kältemittel im Automobilbereich in großem Maßstab möglich ist.
Raeed Mayrhofer und Thomas Hartmann beschrieben die Umstellung auf PFAS-freie Materialien und natürliche Kältemittel bei der ÖBB. Während bei Neuanschaffungen bereits CO₂- oder Propan-basierte Systeme angefordert werden, ist der Austausch bestehender Anlagen oft nicht wirtschaftlich. Hinzu kommt, dass manche PFAS-freie Komponenten – etwa Folierungen oder selbstschmierende Lager – eine etwas geringere Performance aufweisen, was zu zeitlich kürzeren Wartungsintervallen führen kann.
Fazit: Viele Bausteine für einen schrittweisen PFAS-Ausstieg
Der PFAS-Awareness-Workshop VI hat gezeigt, wie eng Fragen des Umwelt- und Produktmonitorings, der Regulierung und der Entwicklung von Alternativen miteinander verknüpft sind. Von der Analyse von Konsumgütern über Bioindikatoren, Abwasser- und Grundwasseruntersuchungen bis hin zu PFAS-freien Baustoffen, Elektronikprodukten und Kältemitteln: Die vorgestellten Projekte liefern wichtige Bausteine für einen schrittweisen Ausstieg aus PFAS – und verdeutlichen gleichzeitig, dass es koordinierte europäische Leitlinien, klare Grenzwerte und den intensiven Austausch zwischen Behörden, Wissenschaft, Industrie und Zivilgesellschaft braucht.
